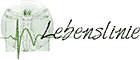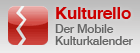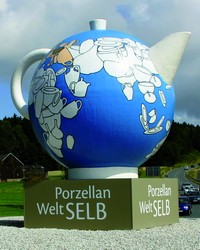 Fast jeder kommt täglich damit
in Berührung. Für den einen
ist es ein wenig beachteter, ja
selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand
des Alltagslebens, für
den anderen ein Kunststück, mitunter
sogar ein „Kultobjekt“, das
Frauen ins Schwärmen geraten
lässt. Namhafte Künstler versuchen
sich immer wieder daran,
das spröde, zerbrechliche, dabei
mit dem Härtegrad eines Diamanten
ausgestattete Material
nach ihren Eingebungen zu formen
und zu schmücken.
Die Rede ist vom Porzellan,
dem „Weißen Gold“ unserer Tage.
Fast jeder kommt täglich damit
in Berührung. Für den einen
ist es ein wenig beachteter, ja
selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand
des Alltagslebens, für
den anderen ein Kunststück, mitunter
sogar ein „Kultobjekt“, das
Frauen ins Schwärmen geraten
lässt. Namhafte Künstler versuchen
sich immer wieder daran,
das spröde, zerbrechliche, dabei
mit dem Härtegrad eines Diamanten
ausgestattete Material
nach ihren Eingebungen zu formen
und zu schmücken.
Die Rede ist vom Porzellan,
dem „Weißen Gold“ unserer Tage.
Der Apothekergeselle Johann Friedrich Böttcher aus Berlin sollte im Auftrag des sächsischen Kurfürsten August des Starken Gold aus minderwertigen Materialien machen, was ihm nicht gelang. Am Ende seiner alchemistischen Versuche aber stand die Erfindung des europäischen Hartporzellans, das für die Fürsten zur Goldgrube wurde. Nachdem das „Arkanum“, das Geheimnis um die Herstellung des begehrten Stoffes, langsam bekannt wurde, entwickelten sich an vielen Orten Deutschlands Manufakturen, deren klangvolle Namen noch heute bekannt und geschätzt sind. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert verschlug es den thüringischen Handlungsreisenden und Porzellanmaler Carl Magnus Hutschenreuther aus Wallendorf mit seiner Kiepe voller Porzellanwaren in das Fichtelgebirge.
Schon
mit 18 Jahren handelte er seine
Porzellane im Fränkischen und
im Böhmischen. Dabei führte
ihn sein Weg  auch nach Hohenberg
an der Eger, einen kleinen
Grenzort zu Böhmen. Dort fand
er seine große Liebe - und neben
Feldspat und Quarz auch Kaolin,
den Hauptbestandteil der Porzellanmasse.
Hier siedelte er sich an.
1814 war es dann soweit, er eröffnete
einen Buntwarenbetrieb. Die
Weißware bezog er noch aus Thüringen.
Seit einiger Zeit aber beschäftigte
sich sein rühriger Geist
mit der Frage, wie die langsamen
Manufakturprozesse verkürzt
und die Produktionsmengen gesteigert
werden könnten, ohne
dass die Qualität darunter leiden
musste. 1822, nach acht Jahre
währendem Kampf, unter anderem
auch gegen die Interessen der
königlichen Porzellanmanufaktur
Nymphenburg in München, war
es dann soweit: er erhielt die königlich
bayerische Konzession
für seine Porzellanfabrik. Fortan
stellte er sein eigenes Weißporzellan
her. Das Fichtelgebirge darf
daher als Geburtsort der industriellen
Fertigung dieses Produktes
betrachtet werden und wurde so
zur Keimzelle einer ungeahnten
Entwicklung.
Die Firma florierte und in Gestalt
seines Sohnes Lorenz war
auch die Nachfolge geregelt, so
schien es zumindest.
auch nach Hohenberg
an der Eger, einen kleinen
Grenzort zu Böhmen. Dort fand
er seine große Liebe - und neben
Feldspat und Quarz auch Kaolin,
den Hauptbestandteil der Porzellanmasse.
Hier siedelte er sich an.
1814 war es dann soweit, er eröffnete
einen Buntwarenbetrieb. Die
Weißware bezog er noch aus Thüringen.
Seit einiger Zeit aber beschäftigte
sich sein rühriger Geist
mit der Frage, wie die langsamen
Manufakturprozesse verkürzt
und die Produktionsmengen gesteigert
werden könnten, ohne
dass die Qualität darunter leiden
musste. 1822, nach acht Jahre
währendem Kampf, unter anderem
auch gegen die Interessen der
königlichen Porzellanmanufaktur
Nymphenburg in München, war
es dann soweit: er erhielt die königlich
bayerische Konzession
für seine Porzellanfabrik. Fortan
stellte er sein eigenes Weißporzellan
her. Das Fichtelgebirge darf
daher als Geburtsort der industriellen
Fertigung dieses Produktes
betrachtet werden und wurde so
zur Keimzelle einer ungeahnten
Entwicklung.
Die Firma florierte und in Gestalt
seines Sohnes Lorenz war
auch die Nachfolge geregelt, so
schien es zumindest.
Doch der Sprössling ging eigene Wege. Nach dem Tod des Stammvaters Carl Magnus 1845 führte die Witwe Johanna die Geschäfte mit allen erwachsenen Kindern in gewohnter Manier weiter, solide und konservativ. Das passte dem designierten Juniorchef gar nicht, er wollte neue Ideen verwirklichen und stritt mit der Mutter darüber. Man konnte sich nicht einigen und Lorenz ließ sich sein Erbteil von 40.000 Gulden ausbezahlen, um eine neue Firma zu gründen. Seit 1855 stand er mit Selb, damals ein Bauern- und Weberdorf, in Verhandlungen wegen der Neuansiedlung eines Industriebetriebes. So war es schließlich Lorenz Hutschenreuther, der nach einem verheerenden Brand 1856 in Selb - hier blieben nur drei Häuser von den Flammen verschont - dort 1857 seine Produktionsstätte einrichtete und damit die Karriere der Porzellanstadt begründete. Neben Hutschenruther entwickelte sich durch den begabten Porzellanmaler Philipp Rosenthal, der das von Hutschenreuther bezogene Weißporzellan mit unterschiedlichen Dekoren bezog, das gleichnamige Porzellanwerk zum zweiten Hauptproduzenten. Seinem Enkel Philip blieb es vorbehalten, mit seiner Philosophie der „Kunst für den Alltag“ Weltruhm zu erringen.
Herausragende Künstler unserer Zeit wie Otmar Alt, Bjørn Wiinblad, Marcello Morandini, Dorothy Heffner und viele andere, entwarfen Formen und Dekore für Rosenthal, Gläser, Möbel und Bestecke ergänzten die Zutaten für den schön gedeckten Tisch. Wem die Beschäftigung mit Porzellan Lust macht, auch selbst einmal seine eigenen künstlerischen Neigungen auszuprobieren, dem kann geholfen werden. Eine Reihe von Porzellanmalschulen vermitteln Grundkenntnisse, aber auch höhere Weihen. Und die selbst bemalten Stücke kann man nach dem Brennen mit nach Hause nehmen. Objekte der Lust sind meist Teller, die sich recht gut bemalen lassen. Doch auch Tassen, Kannen und Vasen eignen sich trefflich als Erinnerungsstücke an kreative Stunden im Fichtelgebirge.
INFO: Weitere Informationen zum Fichtelgebirge, insbesondere zur Porzellanmetropole Selb gibt es unter www.selb.de